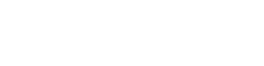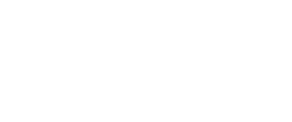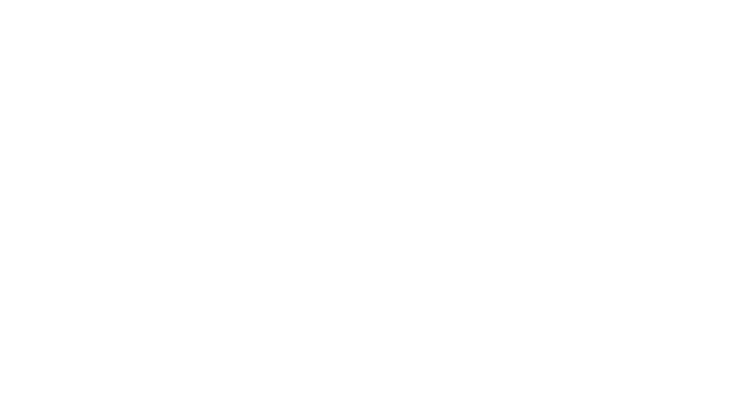→ Mehr dazu in unserer Gnose
→ Mehr dazu in unserer Gnose
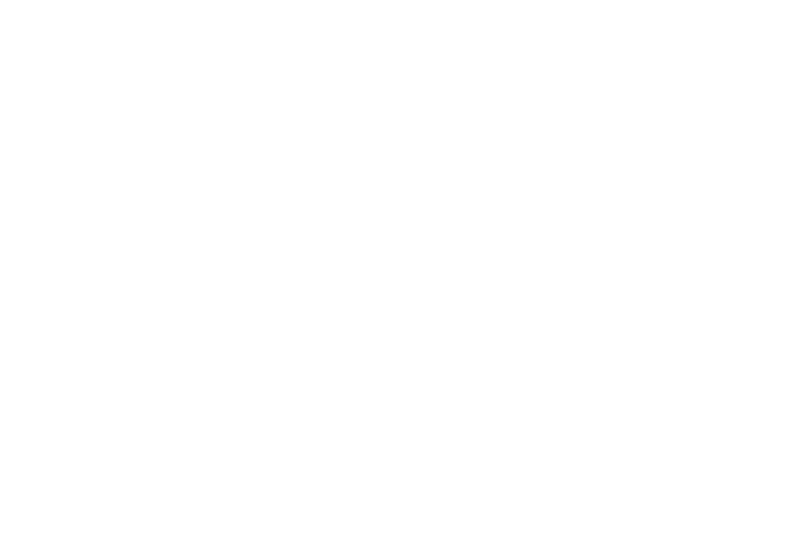
Foto: Alexander Vilf/Host photo agency
→ Mehr dazu in unserer Gnose
Das hat viel mit den Ereignissen zwischen 1941 und 1945 an sich zu tun. Mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 begann einer der verheerendsten Kriege der Menschheitsgeschichte. Die Wehrmacht und ihre Verbündeten führten an der Ostfront einen brutalen Vernichtungskrieg, der auf sowjetischer Seite Millionen von Soldaten und Zivilisten das Leben kostete. Schätzungen gehen von 20 bis 30 Millionen Opfern aus. Der Blutzoll war auch deshalb hoch, weil Stalin Hunderttausende von Rotarmisten ohne Rücksicht auf Verluste in zunächst aussichtslose Schlachten warf.
Nicht alle, die im Krieg gegen NS-Deutschland kämpften oder als Zivilisten umkamen, waren ethnische Russinnen und Russen. Die UdSSR war ein Vielvölkerstaat mit dutzenden Sprachen und Ethnien. In der Roten Armee dienten Menschen aus allen sowjetischen Teilrepubliken, etwa der Ukraine, Belarus, Armenien oder Turkmenistan. Ein Großteil der Gräueltaten der deutschen Besatzer fanden zudem in Gebieten statt, die heute Teil der Ukraine und Belarus sind.
Wieso „Großer Vaterländischer Krieg“ und nicht „Zweiter Weltkrieg“?
Anders als in Westeuropa und Nordamerika erinnert man sich in Russland nicht an den Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945, sondern an den Großen Vaterländischen Krieg gegen Deutschland 1941 bis 1945. Dieser begann mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und endete mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am Abend des 8. Mai 1945. Da es zu diesem Zeitpunkt in Moskau wegen der Zeitverschiebung bereits nach Mitternacht war, wird der Tag des Sieges am 9. Mai begangen.
Woher kommt die Bezeichnung „Großer Vaterländischer Krieg“?
Der Krieg gegen Hitlerdeutschland wurde von der sowjetischen Staatsführung und den Medien schon bald nach Kriegsausbruch als „Großer Vaterländischer Krieg“ taxiert. Der Name ist eine Anspielung auf den „Vaterländischen Krieg“ gegen Napoleon im Jahr 1812 und rief die Vorstellung eines patriotischen Verteidigungskampfes für die Heimat hervor – eine Rahmung, die auch für die heutige Gedenkkultur in Russland eine entscheidende Rolle spielt.
Wie lief dieser Krieg ab?
Die deutschen Truppen und ihre Verbündeten führten einen ideologisch motivierten Vernichtungskrieg gegen die UdSSR und ihre Bevölkerung. In den ersten Monaten konnten sie große Geländegewinne erzielen. Bereits im Herbst 1941 stand die deutsche Wehrmacht vor Moskau. Die Rote Armee schaffte es jedoch, die Hauptstadt zu halten. Im Winter 1942/43 kam mit der Schlacht von Stalingrad der Wendepunkt. In den folgenden Monaten drängte die Rote Armee die Wehrmacht westwärts aus dem Land. Die sowjetische Offensive stoppte jedoch nicht an den Landesgrenzen, sondern rollte weiter nach Westen. Im April 1945 schließlich erreichte die Rote Armee Berlin.
Was bedeutete die deutsche Besatzungsherrschaft für die Menschen in der Sowjetunion?
Die Kampfhandlungen an der Ostfront wurden von unermesslichem menschlichen Leid begleitet. Das Regime in Berlin betrachtete die Slawen als „Untermenschen“, die es zu beseitigen galt, um Platz für den „deutschen Lebensraum im Osten“ zu schaffen. Fatal war die deutsche Invasion vor allem auch für die Jüdinnen und Juden auf sowjetischem Territorium, die von den Nazis millionenfach ermordet wurden.
Nicht alle, die im Krieg gegen NS-Deutschland kämpften oder als Zivilisten umkamen, waren ethnische Russinnen und Russen. Die UdSSR war ein Vielvölkerstaat mit dutzenden Sprachen und Ethnien. In der Roten Armee dienten Menschen aus allen sowjetischen Teilrepubliken, etwa der Ukraine, Belarus, Armenien oder Turkmenistan. Ein Großteil der Gräueltaten der deutschen Besatzer fanden zudem in Gebieten statt, die heute Teil der Ukraine und Belarus sind.
Wieso „Großer Vaterländischer Krieg“ und nicht „Zweiter Weltkrieg“?
Anders als in Westeuropa und Nordamerika erinnert man sich in Russland nicht an den Zweiten Weltkrieg von 1939 bis 1945, sondern an den Großen Vaterländischen Krieg gegen Deutschland 1941 bis 1945. Dieser begann mit dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 und endete mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am Abend des 8. Mai 1945. Da es zu diesem Zeitpunkt in Moskau wegen der Zeitverschiebung bereits nach Mitternacht war, wird der Tag des Sieges am 9. Mai begangen.
Entsprechend groß ist das Bedürfnis der Menschen, sich zu erinnern, sei es im Rahmen familiärer Rituale oder aber bei staatlich inszenierten Großveranstaltungen wie der Parade auf dem Roten Platz.
Das Verhältnis zwischen dem Gedenken „von oben“ und den zivilgesellschaftlichen Initiativen ist komplex. Die Trennlinien sind nicht immer einfach zu ziehen. Ein Beispiel dafür bildet das Unsterbliche Regiment. Unter dieser Bezeichnung hat sich in den letzten Jahren eine Tradition herausgebildet, bei der die Menschen anlässlich des 9. Mai Porträtfotos von Angehörigen, die im Krieg waren, vor sich hertragen, wie bei einem Trauerzug. Das Unsterbliche Regiment wurde ursprünglich von einer Gruppe von Journalisten initiiert, die dem staatlichen Paradenpomp am Tag des Sieges eine alternative – stillere – Form des Gedenkens entgegensetzen wollten.
Der Kreml erkannte bald das Potenzial dieser Graswurzelbewegung und integrierte sie in den Kanon seiner geschichtspolitischen Ausdrucksformen. 2015 wurde das Unsterbliche Regiment in die offiziellen Feierlichkeiten auf dem Roten Platz eingebettet. Präsident Putin nahm damals mit einem Foto seines Vaters an der Aktion teil.
Quelle: kremlin.ru unter CC BY 4.0.
→ Mehr dazu in unserer Gnose
Die aufwändig inszenierten Militärparaden auf dem Roten Platz sind Ausdruck davon. Mit viel Pomp und Pathos wird dort den Veteranen sowie der „glorreichen und heldenhaften“ Vergangenheit gehuldigt, aber auch die militärische Potenz Russlands gegenüber äußeren Feinden zur Schau gestellt. Tagespolitik und Beschwörung der Geschichte stehen in einem engen Wechselverhältnis.
Das Fernsehen spielt eine wichtige Rolle bei der Inszenierung der Parade. Der Staatssender Rossija 1 überträgt das Geschehen auf dem Roten Platz in Millionen Haushalte zwischen Kaliningrad und Wladiwostok. Die Kamera heftet sich an die Stiefel der defilierenden Soldaten, rückt die mit Orden und Blumen überladenen Veteranen auf der Tribüne ins Bild und schwenkt immer wieder auf Putin, der den Feierlichkeiten mit ernstem Gesicht zu folgen scheint.
→ Mehr dazu in unserer Gnose
→ Mehr dazu in unserem Visual
Im Feld der patriotischen Erziehung engagiert sich auch die 2012 von Wladimir Putin ins Leben gerufene Russische Militärhistorische Gesellschaft, indem sie etwa Militärcamps für Jugendliche organisiert. Die Organisation, die sich als Nachfolgerin der Imperialen Russischen Militärhistorischen Gesellschaft aus dem Zarenreich versteht, veranstaltet etwa Militärcamps für Jugendliche. In jüngster Zeit war sie auch an der Errichtung mehrerer Weltkriegsdenkmäler beteiligt. Die Organisation fällt darüber hinaus durch betont geschichtsrevisionistische Aktionen auf.
Auch die Populärkultur macht den Krieg zu einem Spektakel für ein Millionenpublikum: Unzählige Filme, Bücher, Comics und sogar Computerspiele widmen sich diesem Thema. Auch Re-Enactments wichtiger Schlachten, wie beispielsweise der Sturm auf den Reichstag im historischen Erlebnispark „Patriot“ außerhalb Moskaus, erfreuen sich großer Beliebtheit. In diesem Zusammenhang wurde in letzter Zeit wiederholt auf eine „Event-isierung“ beziehungsweise „Kommerzialisierung“ des Kriegsgedenkens in Russland hingewiesen. Der Tag des Sieges ist nicht zuletzt auch ein Feiertag, an dem die Menschen zusammenkommen, um sich zu vergnügen.
In Denkmälern – oft aus der sowjetischen Zeit stammend – manifestiert sich das Kriegsgedenken dauerhaft im öffentlichen Raum. Es gibt kaum eine russische Gemeinde oder Stadt, in der nicht ein Kriegsdenkmal stünde. Das reicht vom simplen Gedenkstein bis zur monumentalen Mutter-Heimat-Statue in Wolgograd (ehemals Stalingrad). Auch heute noch werden Denkmäler errichtet, die zuweilen auf die sowjetischen Vorbilder Bezug nehmen. Es gibt aber auch neue Monumente, etwa das 2020 eingeweihte Soldatendenkmal in Rshew, deren Ikonografie sich von der sowjetischen Tradition weitgehend abhebt.
Die Moskauer Geschichtsdeutung von der „Befreiung Europas vom Nazismus“ wird andererseits in vielen ostmitteleuropäischen Ländern – allen voran in Polen – als Provokation empfunden. Neben dem Holocaust und der Besatzung durch die Wehrmacht erinnert man sich dort auch an den Einmarsch der Roten Armee im September 1939, an die stalinistischen Repressionen sowie an die sowjetische Besatzung nach 1945. In der Ukraine gewann diese Deutung besonders seit Ausbruch des Krieges im Osten des Landes 2014, der von Russland mit geschürt wird an Gewicht und prägt heute nicht nur den offiziellen Blick auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts.